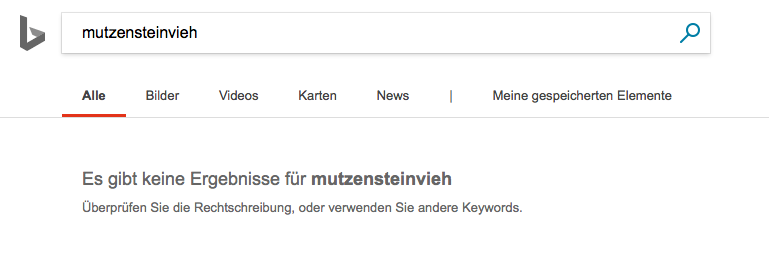Warnung: Der folgende Text enthält das N-Wort in der Ursprungsfassung.
Der einst beliebte, dauerjugendliche, gleichwohl inzwischen etwas in die Jahre gekommene Moderator Thomas Gottschalk hat vor einigen Wochen auf sich aufmerksam gemacht mit seinem Buch, in dem er beklagt, man dürfe heute vieles nicht mehr sagen, was vor einigen Jahren noch zulässig gewesen sei. Ich habe das Buch nicht gelesen und beabsichtige es aus Zeitgründen bis auf weiteres nicht zu tun. Dennoch erlaube ich mir, Herrn Gottschalk zu widersprechen. Man darf durchaus noch alles sagen, was das Strafgesetzbuch nicht ausdrücklich aus guten Gründen verbietet. Schriebe ich zum Beispiel, der alte weiße Mann stamme vom Neger ab, so bliebe das strafrechtlich unverfolgt, dennoch müsste ich als Folge einen gewissen Ansehensverlust in Kauf nehmen, zu recht. Dass wir diesen inzwischen als „N-Wort“ umschriebenen Begriff früher mit Selbstverständlichkeit benutzten, war zumindest von mir keine böse Absicht, wir wussten es einfach nicht besser. Roberto Blanco war einer und der tanzende Sängerimitator von Boney M., Tina Turner eine, ebenso die dunkelhäutige Puppe der Nachbarstochter, und der schokoladenumhüllte Zuckerschaum auf einer Rundwaffel hieß so, auch wenn das mit dem Kuss gar keinen Sinn ergibt. „Denk an die armen N-Kinder in Afrika“ sagte die Oma, wenn der Teller nicht leergegessen wurde. – Heute wissen wir es besser, daher meiden wir solche Wörter, das ist gut und richtig so.
Wobei ich gestehe, manchmal staune ich, welche Begriffe mittlerweile Empörungspotenzial enthalten. Kürzlich etwa war es der „Oberindianer“ aus Udo Lindenbergs altem Hit „Sonderzug nach Pankow“. Ein Berliner Chor sollte oder wollte das Lied ohne dieses Wort singen, um amerikanische Ureinwohner nicht zu grämen. Womöglich ist das den Betroffenen herzlich egal, weil sie ganz andere Probleme haben oder vielleicht demnächst bekommen, wenn Häuptling Orangehaut wieder an der Macht ist.
In bestimmten Kreisen gilt es schon seit längerer Zeit als unschicklich, Personen dem äußeren Anschein nach als Frau oder Mann zu bezeichnen, schließlich wisse man nicht, ob die derart bezeichnete Person sich nicht einem anderen oder keinem Geschlecht zugehörig fühlt, nur noch nicht dazu kam oder es gar nicht beabsichtigt, eine äußere Angleichung vornehmen zu lassen. Statt „Frau“ gab es den Vorschlag, von „Personen mit Menstruationshintergrund“ zu sprechen. Eine komische Vorstellung, etwa an der Fleischtheke oder in der Bäckerei, wenn es heißt: „Ich glaube, die junge Person mit Menstruationshintergrund ist vor Ihnen dran.“ Inzwischen tendiert man diesbezüglich wohl zu „sich weiblich lesende Person“, was die Situation beim Bäcker nicht viel weniger komisch macht.
Beziehungsweise bei der Bäckerin – ein weiteres Thema, das angeblich „die Gesellschaft spaltet“: die geschlechtsneutrale Ansprache einschließlich korrekter Pronomen, auf Neudeutsch gendern. In unterschiedlichen Formen wird es praktiziert: mit Genderstern, Binnen-I, Doppelpunkt, klassisch durch Nennung der männlichen und weiblichen Form wie „Liebe Kolleginnen und Kollegen“. Manche benutzen konsequent die weibliche Form, Männer und alle anderen sind mitgedacht, sagen sie; andere wiederum wechseln innerhalb desselben Textes oder Satzes, dann entstehen irritierende Formulierungen wie „Grundschullehrer und Busfahrerinnen verlangen höheres Gehalt“. Ob das der Sache dienlich ist, ich weiß es nicht.
Und schließlich die Partizipform wie „Radfahrende“. Besonders Sprachpingelige meinen, das sei falsch. Wenn einer, der sonst immer mit dem Rad fährt, heute ausnahmsweise den Bus nimmt wegen Hagel und Sturm, dann sei er eben nicht rad-, sondern busfahrend. (Jedoch kein Busfahrer, der sitzt vorne links; oder die Busfahrerin, klar.) Ein Sonst-immer-Rad-heute-aber-Busfahrender. Mit Verlaub, das halte ich für Unfug. Wer eine junge Person in der Kneipe fragt, was sie denn macht, und zur Antwort bekommt, sie studiere, wird wohl verstehen, was sie meint, auch wenn sie in diesem Moment gerade nicht an ihrer Masterarbeit schreibt. Und aufgepasst: Diese Methode ergibt nur im Plural Sinn, weil ein(e) Studierende(r) nun einmal genauso männlich bzw. weiblich ist wie ein(e) Student(in).
(Das laut Straßenverkehrsordnung vorgegebene Zeichen 237 für einen Radweg bildet übrigens immer ein Herrenrad ab. Gab es dagegen schon Proteste?)
Ein Argument für das Gendern soll eine Studie liefern: Menschen wurden aufgefordert, bekannte Politiker zu nennen. Die derart Befragten nannten überdurchschnittlich viele männliche Politiker. Wurde hingegen nach Politiker:innen (oder eine andere Form) gefragt, wurden mehr Frauen genannt. Das mag sein und ist nachvollziehbar. Doch ist das wirklich ein Problem? Wenn es heißt, Angestellte im Einzelhandel wünschen sich mehr Urlaub, denkt wohl niemand, Verkäuferinnen begnügten sich mit weniger Freizeit.
Ich fremdele mit dem Gendern noch etwas. Im Schriftbild stört es meinen Lesefluss, gesprochen klingt es wie mit erhobenem Zeigefinger. Zugegeben, ein sehr flachwurzelndes Argument. Vielleicht muss ich mich nur noch daran gewöhnen; das dahinterstehende Anliegen kann ich zumindest nachvollziehen, ich zähle mich nicht zu den geifernd-eifernden Gegnern.
Man soll auch nicht mehr Schwule und Lesben sagen, wenn gleichpolig Liebende gemeint sind, denn damit grenzt man andere Lebens- und Liebesformen aus, wie Bi-, Trans-, Inter- und Asexuelle. Stattdessen heißt es nun LGBTQ*…-Community; jeder Buchstabe steht für eine andere Vorliebe und die Reihe scheint jährlich länger zu werden. Bei „Wetten dass..?“, ich glaube noch bevor Thomas Gottschalk es übernahm, trat mal einer auf, der die Zahl Pi auf fünfzig oder mehr Stellen hinter dem Komma fehlerfrei aufsagen konnte. Gäbe es die Sendung noch, könnte dort vielleicht demnächst jemand reüssieren, indem sie oder er alle Buchstaben der oben genannten Reihe hersagen und zudem erklären kann. Ich kann es trotz persönlicher Betroffenheit (für mich bitte das G) nicht.
Jüngstes Beispiel verdächtiger Wörter ist der Lumumba, jenes unter anderem auf Weihnachtsmärkten beliebte Kakaogetränk mit alkoholischer Geschmacksverstärkung. Angeblich geht das Wort zurück auf einen erschossenen schwarzen Freiheitskämpfer, woraus die Herleitung „Brauner mit Schuss“ entstanden sein soll. Das erscheint mit etwas weit hergeholt. Sollte es jedoch stimmen, dass das Getränk aus genau diesem Grund zu seinem Namen kam, so bin ich der letzte, der darauf beharrt, es weiter so zu nennen. Vielleicht wäre Schokohol eine Alternative. Ohnehin trinke ich lieber Glühwein, Eierpunsch und Feuerzangenbowle. Gelegentlich auch nicht-alkoholische Getränke.
Insgesamt erscheint mir ein etwas entspannterer Umgang mit solchen Wörtern manchmal angebracht, das gilt für beide Seiten. Niemandem wird etwas genommen, wenn er Paprikaschnitzel oder Schokokuss sagt. Andererseits muss man nicht in jedes vermeintlich verdächtige Wort Diskriminierungspotenzial hinein interpretieren. Sonst beklagt Herr Gottschalk demnächst die Ächtung von Eisbombe (gewaltverherrlichend), Matjesfilet Hausfrauenart (antifeministisch), Götterspeise (blasphemisch), und die blaue Partei mit der schokofarbenen Gesinnung hat wieder was zu hetzen.
Wobei, das Wort Gottschalk ist bei näherer Betrachtung auch nicht ganz ohne. Aber über Namen macht man sich nicht lustig. Auch nicht, wenn jemand Frauenschläger heißt; allenfalls darf man sich da fragen, womit deren Vorfahren einst ihren Lebensunterhalt bestritten. Vermutlich beließen sie es nicht beim Gebrauch falscher Pronomen.
Apropos schlimme Wörter: Es gibt welche, die völlig unverdächtig und allgemein gebräuchlich sind, die ich gleichwohl gar fürchterlich finde, ohne dass ich begründen könnte, warum. Neben den üblichen Anglizismen wie Call, Meeting und roundabout sind das: schlendern, schmunzeln, schlemmen, stöbern, schlecken, shoppen und lecker. Die darf Thomas Gottschalk weiterhin sagen, niemand außer mir wird daran Anstoß nehmen.