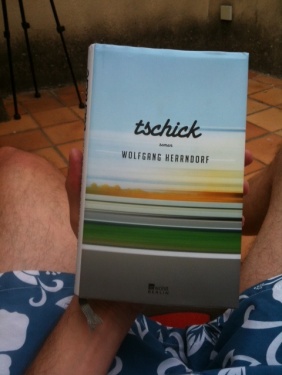Hier noch eine Fundsache: Den nachfolgenden Text entdeckte ich beim Durchstöbern meiner E-Mail-Ablage. Leider kenne ich nicht den Verfasser und kann somit auch keine korrekte Quellenangabe machen, hole das jedoch gerne nach, wenn ihn mir jemand nennt. Die E-Mail stammt bereits aus dem Jahre 2001, jedoch hat der Text meines Erachtens an Aktualität noch nicht sehr viel eingebüßt.
***
Offen gestanden kotzt es mich an: dieses dumme Gerede der derzeitigen „Generation Z“, die 80er Jahre wären langweilig gewesen. Totaler Bockmist.
Hört genau zu, Ihr zungengepiercten Tekknohoppler mit Tattoos auf der linken Arschbacke: Ihr wart nicht dabei! Wir Mit-Dreissiger/-Vierziger haben sie live erlebt: die Geburt des Synthesizers und den wahren Soundtrack der 80er, der von Bands wie Depeche Mode, Cure und Yazoo geschrieben wurde.
Wir haben noch mit Midischleifen und Oszillographen gekämpft! Wir haben Euer Tekkno erfunden, bei uns nannte sich das aber noch „Wave“ und war tatsächlich Musik. (übrigens verwursten Eure DJs die Dinger noch heute zu einer Art musikalischer Canneloni mit schwülstiger Computerbasssosse).
Wir mussten noch keine Angst haben, dass uns Tina Turner mit dem klassischen Seniorenoberschenkelhalsbruch von der Bühne purzelt und wir haben Madonna noch mit festen Brüsten und ohne Baby-Pause gekannt, Ihr Nasen!
Wir verbinden „Kraftwerk“ noch nicht mit Solarenergie und wir hatten noch Angst, dass Joschka Fischer von Holger Börner mit der Dachlatte verprügelt wird. Wir erinnern uns noch an Terroristenfahndungsplakate, auf denen hin und wieder ein Gesicht liebevoll mit Kuli von einem Staatsbediensteten durchgestrichen wurde …
Die Bundeswehr und die NVA machten noch Spaß, wir kannten ja die Richtung, aus der der Feind kommt …
Zu unserer Zeit fielen Break-Dancer auf den Fussgängerzonen noch hin und wieder richtig auf die Fresse und Peter Maffay wurde beim Stones-Konzert noch ordentlich von der Bühne gepfiffen. Wir hatten noch Plattenspieler (auf 33″ und 45″) und richtig geile Plattencover, auf denen man die Namen der MUSIKER (und nicht der Programmierer) ohne Lupe erkennen konnte und die tatsächlich Kunst waren – keine Tempotaschentuchgrossen, einfarbigen Booklets auf denen gerade noch „nice Price“ lesbar ist.
Für uns war eine LP etwas Heiliges, das gepflegt und geliebt werden musste – und keine CD-Plastik-Wegwerfware, die so robust ist, dass man sie durchaus auch als Bierglasuntersetzer verwenden kann. Bei uns erkannte jeder sein Eigentum noch an den individuellen Kratzern.
Wir haben kein „Big Brother“ geguckt sondern „Formel 1“, wo es eine ganze fette Stunde wirklich gute Musikvideos zu sehen gab, die das Lied untermalten, wir hatten kein MTV mit degenerierten CD-Werbespots nötig.
Wir liessen uns die Haare seitlich ins Gesicht fallen – ohne diese beknackten, umgedrehten Baseballmützen oder Wollhauben. In unseren Hosen konnte man sehen, ob einer einen Hintern hatte, heute hängt der Arsch ja bei jedem von Euch in der Kniekehle der achso tollen Baggy-Trousers.
Bei uns haben sich keine Neonazis mit Türken gekloppt, sondern Punks mit Teds, Teds mit Poppern, Popper mit Ökos und Ökos mit der Polizei…
Und wer einen Führerschein hatte, fuhr als erstes einen Käfer oder eine Ente, bei der Dellen von Individualismus zeugten, ihr Opel-Corsa-Popel!
Und weil ihr gerade im Leistungskurs Informatik sitzt: die AC/DC Einritzungen auf den Tischen sind von UNS – und es geschieht Euch nur recht, wenn ihr glaubt, dass die Dinger aus dem Physiksaal kommen, wo irgendein findiger Schüler seinerzeit die Abkürzung für „Starkstrom/Schwachstrom“ in die Bank gemeisselt hat!
Also erzählt uns nichts über die 80er. Und ja, hiermit entschuldige ich mich, auch im Namen meiner Altersgenossen, für Modern Talking. Das haben wir nicht gewollt…