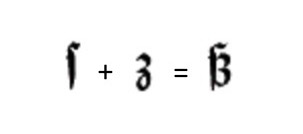Ich bin mir nicht sicher, ob ich über das, was vergangene Woche in der Zeitung stand, traurig oder wütend sein soll. Dort war zu lesen über den Kölner Sven Lüdecke, der in seiner Freizeit und auf eigene Kosten kleine bewegliche Holzhäuschen baut. Die schenkt er Menschen, denen es nicht vergönnt ist, sich nach Feierabend in die warme Wohnung auf das Sofa zurückzuziehen.
Die Obdachlosen – darf man das noch schreiben oder ist das inzwischen auch irgendwie diskriminierend? – die Menschen ohne feste Bleibe also nehmen die Häuschen gerne an, haben sie doch eine Tür, hinter die sie sich mal ungestört und wettergeschützt zurückziehen können.
Doch o weh, der Häuschenbauer hat nicht die Stadt Köln gefragt, und die mag die Häuschen nicht. Die Begründung könnte deutscher nicht klingen: Bei den Häuschen handele es sich um „eine Unterkunft ohne Strom, Wasser, Kanal, Heizung und ohne ausreichende Stehhöhe“, so eine Pressesprecherin, daher seien sie „für die dauerhafte Nutzung als Wohnraum […] nicht genehmigungsfähig.“ Gewiss. Zudem fehlen schnelles Internet, Flachbildfernseher, Whirlpool, Wintergarten und Stuckdecken. Auch verstoßen sie vermutlich gegen geltende Energiesparnormen für Neubauten. Daher ist es besser, die Menschen weiterhin im Freien schlafen zu lassen, frische Luft ist ja auch gesund.
„Köln ist eine mitfühlende Stadt“, sagt die Pressesprecherin und verweist auf „eine große Vielfalt von Angeboten für diesen Personenkreis“. Diese Meinung teilt dieser Personenkreis jedoch nicht uneingeschränkt, weil er in den Unterkünften schlechte Erfahrungen mit Diebstahl und auch Gewalt gemacht hat.
Aber vielleicht haben sich auch einige Wohlfühlanspruchsbürger beschwert, weil diese Kisten in Sichtweite ihrer Villa standen? Oder Vermieter, die nun befürchten, ihre überteuerten Wohnungen nicht mehr loszuwerden, weil plötzlich alle in so einem Häuschen wohnen wollen? Und denkt bitte mal einer an die Kinder? Kinder leiden ja immer am meisten.
„Sobald Boxen auf städtischem Grund stehen, werden sie abgeräumt“, so eine Sprecherin. Hoffentlich können die Bewohner die Häuschen dann rechtzeitig verlassen, bevor die Sperrmüllpresse sie in Sondermüll umwandelt.
Liebe Stadt Köln, ich vermisse die rheinische Gelassenheit! Unterstützt lieber diese Initiative, stellt Material zur Verfügung, vielleicht sogar etwas Geld; vor allem aber: Weist Flächen aus, wo die Häuschen aufgestellt werden dürfen! Es muss ja nicht gleich die Domplatte sein.
Klar: Die Häuschen lösen nicht das Problem Obdachlosigkeit. Und doch lassen sie vielleicht einen Hoffnungsschimmer erahnen, auf dass das Leben auf der Straße, im Zelt oder unter der Brücke ein klein wenig besser werde. Nicht nur in Köln.
Inzwischen hat Sven Lüdecke einen Verein gegründet. Wenn Sie, liebe Leser, dieses Projekt unterstützen möchten, können Sie das hier tun:
Little Home Köln
Spendenkonto:
IBAN DE96 3705 0198 1933 6044 47
BIC COLSDE33XXX
***
Hier noch ein paar Links dazu: