Montag: Bereits gestern gelesen im Kieselblog: „Todos bauen sich auf wie Gewitterwolken, unter mir ein Teppich aus Lustlosigkeit.“ Ein Satz, der die montägliche Stimmung fast perfekt auf den Punkt bringt, sieht man einmal über den einleitenden Anglizismus großzügig hinweg. Doch so schlimm war es heute gar nicht, meine Stimmung war zufriedenstellend. Vielleicht lag es an der zusätzlichen Bewegung: Wegen eines technischen Defekts fielen ab Mittag die Aufzüge aus, so erhielt (nicht nur) ich Gelegenheit, gleich dreimal die Treppen zu nutzen, zweimal runter und (planmäßig) einmal hoch, rund 1.460 Stufen insgesamt. Da zahlt es sich aus, wenn man das freiwillig regelmäßig macht.

Dienstag: Zu Fuß ins Werk und zurück, erstmals in diesem Jahr ohne Jacke, da fühle ich mich anfangs immer wieder etwas unvollständig. Ich bin grundsätzlich ein Jackenmensch, so wie Mann früher nur mit Hut aus dem Haus ging. Auf dem Rückweg genehmigte ich mir in einer innerstädtischen Außengastronomie einen Maibock, der auch im Juni noch schmeckt, und schaute den Leuten beim Vorbeigehen zu.
Ich sollte mir abgewöhnen, Menschen, die beim Gehen ununterbrochen auf das Datengerät schauen, „Du Opfer“ zuzurufen, wenn auch nur gedanklich.
„Ich melde mich gleich bilateral bei dir“, hörte ich in einer Besprechung. Manche Wörter mögen klug oder wenigstens geschäftig klingen, gleichwohl verlöre der Satz nichts an Sinn, ließe man sie einfach weg.
Aus der Zeitung: „Die Vorgebirgsbahn S23 von Bonn nach Euskirchen soll elektrifiziert werden. Das heißt, die mit Diesel betriebenen Loks werden abgeschafft.“ Das ist Unfug: Erstens ist die Vorgebirgsbahn die heutige Straßenbahnlinie 18 von Köln über Brühl nach Bonn, gemeint ist vielmehr die Voreifelbahn. Kann passieren, auch einem Journalisten. Zweitens fahren dort seit sechsundzwanzig Jahren keine Dieselloks mehr, sondern Dieseltriebzüge. Zugegeben, eine Marginalie. Jedenfalls werden diese drittens nach Elektrifizierung der Strecke, wenn sie irgendwann mal fertiggestellt sein sollte, sofern sich keine Bürgerinitiative gegen dafür erforderliche Baumfällungen bildet und am Bahndamm keine seltene Echsen wohnen, ganz bestimmt nicht abgeschafft, sondern woanders eingesetzt.
Mittwoch: Eine Beobachtung, die ich kürzlich schon erwähnte, bestätigt sich zunehmend, jedenfalls ist das mein persönlicher Eindruck: Junge Kollegen grüßen nicht mehr. Egal, ob jemand den Aufzug betritt oder mir auf dem Flur im Turm begegnet, er/sie sagt nichts, unabhängig davon, ob seine/ihre Aufmerksamkeit gerade dem Datengerät gilt. Wenn ich dann Hallo sage oder was man halt so sagt je nach Tageszeit, werde ich angeschaut wie eine fremde Spezies oder als hätte ich einen dem Gegenüber unbekannten Zeichensatz verwendet. Ich bewerte das nicht, nehme es nur zur Kenntnis. Im Grunde ist eine Grußfloskel entbehrlich, manchmal vielleicht ein „Guten Morgen“ gar verlogen. Immerhin sagen sie auch nicht mehr „Mahlzeit“, das mal positiv sehen.
Aus einer Gruppennachricht: „Wir sollten bitte hier uns multilateral besprechen, denn ich glaube mein Sätze haben keine Klarheit gebracht.“ Dieser jedenfalls nicht sehr viel.
Donnerstag: Es lebe die Viertagewoche. Den heutigen freien Tag nutzte ich wieder für eine Wanderung, wegen Regenankündigung zum Nachmittag ohne längere An- und Abreise. Mit dem Bus fuhr ich bis Bonn-Röttgen, von dort ging ich eine Rundstrecke durch den Kottenforst, die mir mal auf Komoot vorgeschlagen wurde. Die Strecke ist abwechslungsreich, sie führt überwiegend durch den Wald. Es gibt einige Steigungen zu überwinden, indes keine fiesen Stolperstellen wie beim letzten Mal auf dem Siegsteig; gestolpert bin ich nur einmal noch innerhalb von Röttgen über eine hervorstehende Gehwegplatte. Die ersten Kilometer entlang des Katzenlochbachs sind besonders idyllisch, allerdings nach den Regenfällen der letzten Tage auch stellenweise matschig, entsprechend sahen die Schuhe hinterher aus.
Fazit: Eine schöne Wanderstrecke mit Variationsmöglichkeiten. Beispielsweise könnte man über den Venusberg weitergehen bis Bonn-Innenstadt statt wieder zurück nach Röttgen. Vielleicht mache ich das demnächst mal, wenn kein Regen zu erwarten ist. Der kam übrigens viel später als erwartet, auch die anschließende Currywurst mit Belohnungsbier in der Stadt konnte ich noch trocken draußen genießen.






Freitag: Mittags in der Kantine saßen am Nebentisch zwei Männer, die sich auf Englisch unterhielten. Wobei „unterhielten“ nicht das richtige Wort ist, vielmehr redete der eine ununterbrochen auf den anderen ein in einem harten, ohrenscheinlich nicht muttersprachlichen Akzent, und sehr laut, derweil er, wen wunderts, mit dem Verzehr seiner Pizza nicht vorankam; soweit ich es aus den Augenwinkeln beobachten konnte, aß er während der ganzen Zeit, von meiner Platznehmung bis nach dem Dessert, keinen Bissen davon, inzwischen musste die Pizza kalt sein. Sein Gegenüber tat mir ein bisschen leid. Wieder einmal freute ich mich, allein am Tisch zu sitzen, wo ich mich unbesprochen der Reibekuchen an Salat und Apfelmus annehmen konnte.
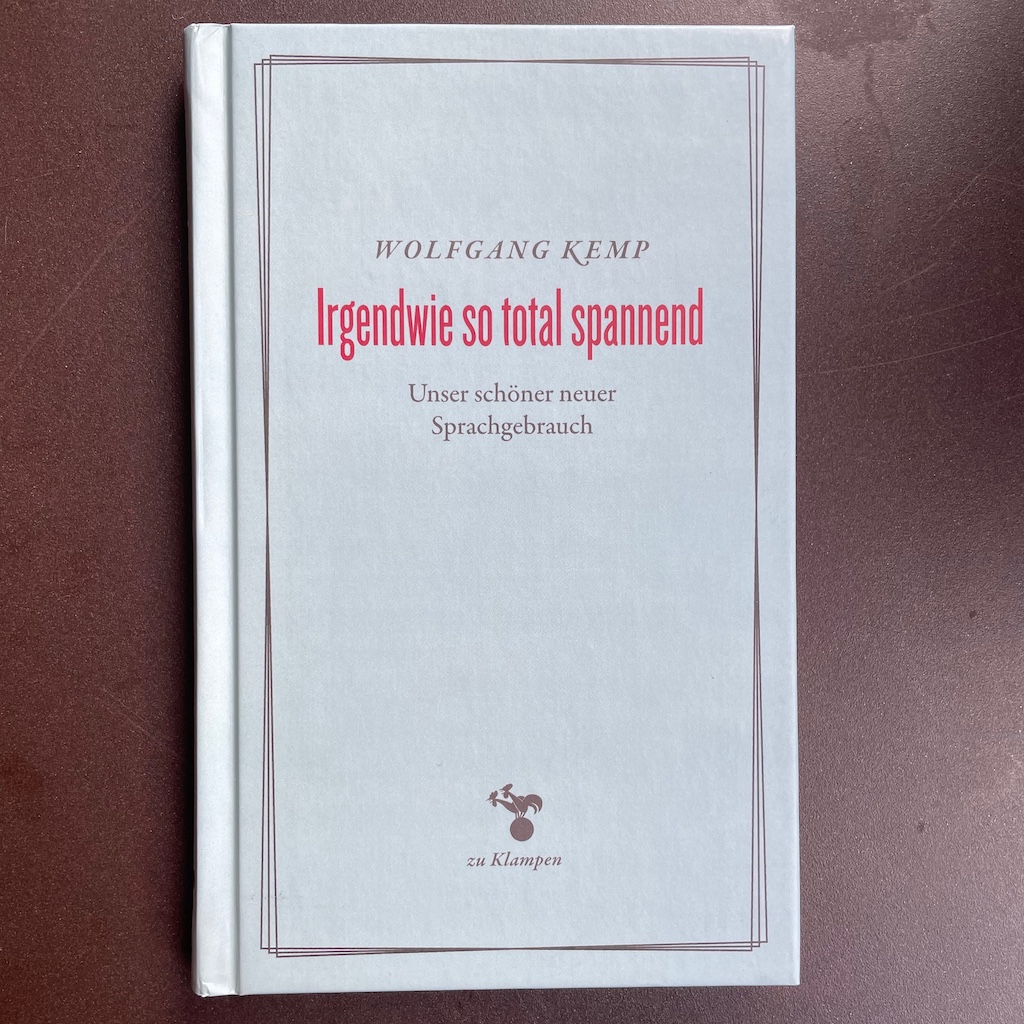
Samstag: Wie üblich verband ich auch heute die Altglasentsorgung mit einem Spaziergang an den Rhein. Auf dem Rückweg begegnete mir eine Familie aus Vater, Mutter und drei Kindern. Auffällig war, sowohl der Vater als auch die Söhne zwischen schätzungsweise zwei und sieben Jahren, der jüngste im Kinderwagen, waren fast kahl geschoren, nur dunkle Stoppel waren noch auf den Köpfen auszumachen, eher Schatten denn Haare. Die Mutter, die den Kinderwagen schob, trug ein Kopftuch, daher war nicht auszumachen, ob auch sie haarlos war. Vielleicht hat es einen religiösen Hintergrund, ich weiß es nicht. Jedenfalls insgesamt ein mindestens irritierender Anblick.
Es ist an der Zeit für die nächste der tausend Fragen.

Frage 4 lautet: „Über welche Witze kannst du richtig laut lachen?“ Da gibt es keine bestimmte Kategorie, wie Blondinen-, Ostfriesen- oder Schweinkramwitze. Grundsätzlich kann ich über jeden guten Witz mehr oder weniger laut lachen, leider kann ich mir nur keinen merken. Doch, einen einzigen aus unerfindlichen Gründen schon, der ist allerdings nur so mittelgut. Ich habe ihn hier im Blog schonmal erzählt, aber wenn Sie unbedingt wollen, nochmal. Er geht so: Ein Dalmatiner steht an der Supermarktkasse. Als er an der Reihe ist, fragt die Kassiererin: „Sammeln Sie Punkte?“ Ach ja, richtig laut lachen kann ich auch über Horst Evers, siehe Eintrag von vorletzter Woche, und den Sitzungspräsidenten Volker Weininger. Überhaupt nicht lachen kann ich hingegen über sogenannte Comedy im Radio, erst recht nicht wenn die Stellen, an denen man lachen soll, mit einem sausenden Geräusch gekennzeichnet sind.

Sonntag: Das Wetter zeigte sich heute kleinteilig abwechslungsreich, jeweils kurze trockene Phasen wechselten sich ab mit teils heftigem Regen und starkem Wind. Erst zur Spaziergangszeit am frühen Nachmittag beruhigte es sich und die dafür zuständigen himmlischen Instanzen sahen freundlicherweise von weiteren Regengüssen ab, dennoch rüstete ich mich vorsichtshalber mit Regenjacke und Schirm. Später zeigte sich sogar für längere Zeit die Sonne und sie lockte die Leute aus den Stuben, in kurzen Hosen oder Daunenjacken, manche trugen beides gleichzeitig.
Ungeachtet meteorologischer Unwägbarkeiten fand auf der Beueler Rheinseite ein mutmaßlich sportliches Ereignis statt, jedenfalls deuteten Applaus und unentwegtes Plappern des lautsprecherverstärkten Kommentators darauf hin.
In der Südstadt ist eine weitere Straße aufgerissen zur Leitungsverlegung oder ähnlichem. Mein Eindruck ist, in Bonn gibt es immer mehr Baustellen, nur werden diese nie fertig. So ein bisschen wie Stuttgart 21. Fertig hingegen ist nun dieser Wochenrückblick.


***
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, kommen Sie gut durch die Woche.
Redaktionsschluss: 16:45




